Anforderungen an Privatsphäre und Datenschutz
Wie medizinische KI vertrauenswürdig wird

Künstliche Intelligenz (KI) verändert mit intelligenten Systemen gerade die Medizin. Die meisten KI-Anwendungen basieren auf Modellen für Maschinelles Lernen. Diese werden anhand von Patientendaten trainiert, um bestimmte Muster zu erkennen. Je mehr dieser Daten in das Training mit einfließen, umso genauer sind Diagnosen und Prognosen.
In der Medizin unterstützen solche KI-Systeme Ärztinnen und Ärzte inzwischen sehr erfolgreich bei der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten, der Analyse von Röntgenbildern, und in vielen anderen medizinischen Gebieten. Doch die rasante Entwicklung in diesem Bereich wirft auch Fragen grundsätzlicher Art auf: Sind die KI-Systeme ebenso verlässlich wie ein menschlicher Arzt? Können ihnen medizinische Anwender vertrauen? Und werden die für das Modelltraining genutzten Patientendaten sorgsam behandelt?
Der Informatiker Daniel Rückert von der TUM arbeitet daran, dass automatische Systeme ähnlich vertrauenswürdig sind wie ein menschlicher Arzt – für die Akzeptanz der Programme ein unerlässlicher Faktor: „Wir haben in der Medizin zwei Gruppen von Menschen, mit denen ein KI-System interagiert“, sagt Daniel Rückert. „Die eine Gruppe sind Ärzte und Kliniker und die andere die Patienten. Beide Gruppen haben sehr hohe Anforderungen, die sie an andere Menschen stellen würden, wenn sie in Entscheidungsprozessen mit eingebunden sind.“
Diese Anforderungen sollten auch KI-Systeme erfüllen: Sie sollten beispielsweise mit den persönlichen Daten von Patienten sorgfältig umgehen und keine identifizierbaren Informationen abspeichern – also die Privatsphäre wahren. Sie sollten fair sein und beispielsweise Männer nicht anders als Frauen behandeln. Und sie sollten angeben, wie sicher ihre Entscheidungen sind. Denn wie ein menschlicher Arzt wird auch eine KI manche Diagnosen zwar mit 99 Prozent Sicherheit stellen können, andere aber vielleicht nur mit 80 Prozent. Und das muss das System möglichst transparent kommunizieren.
„Generell gibt es viele Definitionen und Kategorisierungsansätze für vertrauenswürdige KI“, sagt Dr. Georgios Kaissis aus dem Team von Prof. Rückert. Der Konsens dabei ist, dass intelligente Systeme in der Medizin im weitesten Sinn ähnlich agieren sollten wie ein verantwortungsbewusster Arzt. „Eine vertrauensvolle KI muss mit menschlichen Werteinstellungen vereinbar sein“, sagt Kaissis. „Der Output solcher Systeme sollte menschlichen Grundwerten – wie etwa Fairness oder Schutz von Daten – nicht widersprechen.“
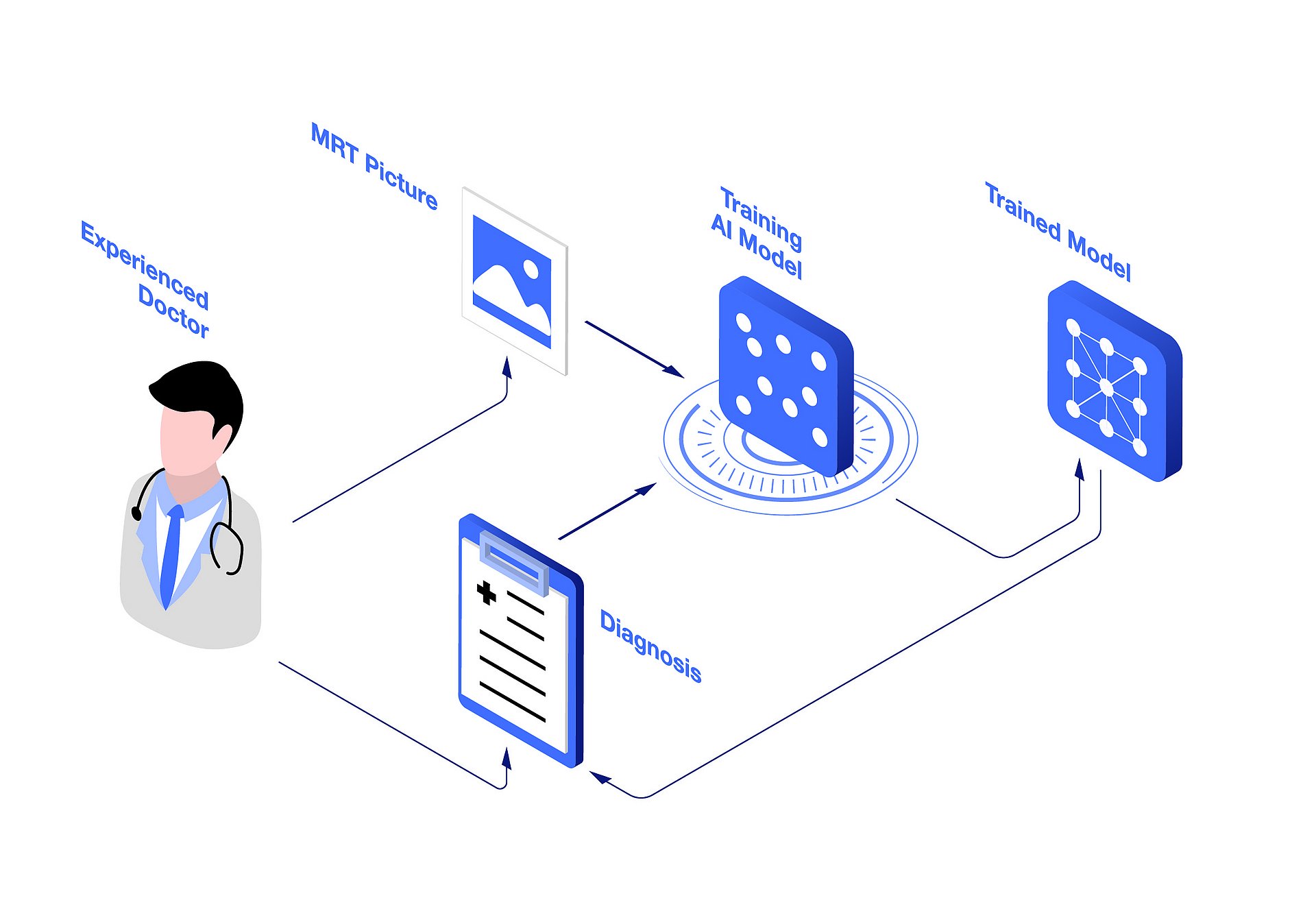
Dilemma Datenschutz
Daniel Rückert hat mit seinen Forschungsgruppen unter anderem die Themen Fairness und Transparenz im Fokus – und als aktuellen Schwerpunkt die privatsphärewahrende KI. Privatdozent Georgios Kaissis leitet die Forschungsgruppe zu dem Thema. Den Radiologen und Informatiker beschäftigt die Frage: Wie kann man KI-Modelle mit den Daten von Patienten trainieren, ohne dass diese Daten wieder aus den Modellen rekonstruiert werden können.
Die Relevanz dieser Frage darf nicht unterschätzt werden. Grundsätzlich sind Patientendaten, wie beispielsweise MRT-Bilder, unerlässlich für das Training der KI-Modelle. Diese Patientendaten sind aber aus zwei Gründen problematisch: Zum einen stehen diese Daten in der Medizin nicht in der Häufigkeit zur Verfügung, wie bei nicht-medizinischen KI-Anwendungen – wo Millionen oder gar Milliarden von Trainings-Datensätzen üblich sind. Man muss sich hier mit weniger begnügen – was die Verlässlichkeit der Modelle und Diagnosen einschränken kann.
Zum anderen sind die für das Training verwendeten Gesundheitsdaten hochsensibel und äußerst schützenswert. Krankheit ist schließlich Privatsache – Mediziner dürfen solche Daten prinzipiell nicht ohne Zustimmung der Betroffenen aus der Hand geben, auch nicht, um damit ein Computersystem zu trainieren, das künftig Leben retten kann.
Beide Herausforderungen – zu wenig Daten und sehr sensible Daten – lassen sich durch zuverlässigen Privatsphärenschutz lösen. Weitgehend etabliert als Verfahren, solche Daten hinreichend zu schützen, haben sich Anonymisierung und Pseudonymisierung. Bei der Anonymisierung werden die Namen oder identifizierenden Informationen komplett aus dem Datensatz entfernt. Die CD „Bob Dylan“ „Greatest Hits“ kann durch Löschung des Namens anonymisiert werden, so dass der Datensatz nur mehr den Eintrag „Greatest Hits“ enthält. Bei der Pseudonymisierung wird der Name „Bob Dylan“ durch einen anderen Namen ersetzt wie „Bob Marley“.
Der Haken an der Sache: Anonymisierung und Pseudonymisierung sind inzwischen nicht mehr sicher. Die Angriffsmöglichkeiten gegen die KI-Modelle sind so mächtig geworden, dass selbst sehr gut anonymisierte Daten relativ einfach zu re-identifizieren sind. „Die bloße Entfernung des Namens ist für neuartige Angriffsmethoden völlig belanglos“, erklärt Georgios Kaissis. „Wir konnten in unseren Arbeiten mehrfach zeigen, dass Patientendaten wieder aus den Modellen heraus rekonstruiert werden können, wenn man diese ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen trainiert.“ So ist es Kaissis mit seinen Mitarbeitern beispielsweise gelungen, Röntgenbilder von Patienten wieder aus den Modellen komplett zu rekonstruieren - ein Desaster für den Datenschutz.
Dennoch werden in der Praxis Anonymisierung und Pseudonymisierung weiter genutzt. „Das liegt an der Diskrepanz zwischen dem Stand der Forschungsergebnisse und dem rechtlichen Rahmen“, sagt Kaissis. „Juristisch gelten anonymisierte Daten nach wir vor als nicht personenbezogen und sind deshalb rechtlich zulässig. Die Forschung zeigt allerdings, dass Anonymisierung nicht sicher ist.“ Erforderlich wäre deshalb eine Novelle des rechtlichen Rahmens.
Neben dem Schutz der sensiblen Daten kann eine KI, die die Privatsphäre wahrt, auch das Problem der zu geringen Datenmengen lösen – wenn auch nur indirekt: Eine KI, die die Privatsphäre wahrt, ist nämlich für Anwender und Datengeber vertrauenswürdig und wirkt damit stark motivierend auf Patienten, dass sie ihre Daten zur Nutzung freigeben. Es stehen dann mehr Trainingsdaten zur Verfügung, was die Modelle zuverlässiger und robuster macht.
Die Anforderungen an KI-Systeme sind hoch. Sie sollen mit persönlichen Daten sorgfältig umgehen und keine identifizierbaren Informationen speichern
Mathematische Garantie
Daniel Rückert und sein Team um Georgios Kaissis nutzen mit Differential Privacy ein Verfahren, das die Limitierungen und Unsicherheiten von Anonymisierung und Pseudonymisierung hinter sich lässt. Im Wesentlichen beruht Differential Privacy darauf, dass beim Training der KI-Systeme den Daten „kalibriertes statistisches Rauschen“ – also zufälliges Rauschen – hinzugefügt wird. Das Ganze ist mathematisch komplex, führt aber dazu, dass die Privatsphäre von einzelnen Patienten gewährleistet ist.
Der große Pluspunkt von Differential Privacy: Die Methode gibt – anders als herkömmliche Verfahren – mathematische Garantien, dass sie weder durch aktuelle noch durch zukünftige Angriffe unterminiert werden kann. Während eine empirische Garantie nur sicherstellt, dass ein aktueller Angriff abgewehrt wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein zukünftiger Angriff diese Garantie umgeht.
Eine mathematische oder formale Garantie ist hingegen eine Garantie, die weder jetzt noch in der Zukunft jemals umgangen werden kann. Diese formale Garantie ist deutlich stärker als eine bloße empirische – sie ist umfassend und unabhängig vom Stand der Technik. „Wenn ich den Datenschützer vom Klinikum rechts der Isar davon überzeugen will, dass er mir erlaubt, solche Verfahren einzusetzen, dann ist es natürlich für diesen sehr viel attraktiver, wenn ich ihm sagen kann: Ich kann mathematisch garantieren, dass man daraus den Patienten nie re-identifizieren kann,“ sagt Rückert.
Differential Privacy hat aber noch weitere Vorteile. So erlaubt es die Methode, Modelle mit einem „Privatsphären-Budget“ zu trainieren. Dieses Privatsphären-Budget funktioniert analog wie ein Einkauf, bei dem ein bestimmter Betrag Geld ausgegeben werden kann. Übertragen auf den Datenschutz heißt das: Wenn man durch mehrere Iterationen (Rechendurchgänge) mit privaten Daten das Privatsphären-Budget aufgebraucht hat, dann verbietet das System, dass man weiter mit diesem Datensatz interagiert – er wird einfach gesperrt.
„Mit dem Privatsphären-Budget kann zum Beispiel (jeder Patient oder) jede teilnehmende Institution eine quantitative Menge an Privatsphäre festlegen, die sie gerne für das Training dieses Modells aufwenden möchten“, erklärt Rückert. „Dieses Budget korreliert mit dem Risiko einer Re-Identifikation von Datensätzen. Je höher das Budget wird, desto höher wird das Risiko, dass meine Daten wieder heraus rekonstruiert werden können.“
Ob das auch in der Praxis umsetzbar ist, hat Rückerts Team kürzlich untersucht. Dazu wurde ein Datensatz mit Röntgenbildern von Patienten verwendet, um Algorithmen damit zu trainieren. Der Test war erfolgreich: Es gelang mit den im Krankenhaus trainierten Algorithmen, Röntgenbilder verlässlich zu analysieren und zu zeigen, dass sie vor Angriffen von außen geschützt sind. „Wir haben das im Journal „Nature Machine Intelligence“ in einer Veröffentlichung gezeigt, dass es ganz konkret in einer Fallstudie funktionieren kann“, so der Forscher.
Dieser Text wurde im Magazin Faszination Forschung, Ausgabe 31, veröffentlicht. Sie finden unter dem Link die Inhalte des Magazins und können einzelne Artikel oder die gesamte Ausgabe herunterladen.